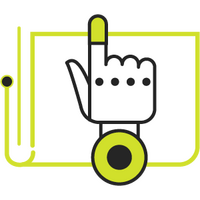Einerseits ist zwischen der Form der Vereinbarung einer längeren Zahlungsfrist und deren Vereinbarung dem Inhalt nach zu unterscheiden. Nach österreichischem juristischem Sprachgebrauch erfolgt eine ausdrückliche Willenserklärung durch Worte oder allgemein angenommene Zeichen; im Gegensatz dazu wird bei einer stillschweigenden (= schlüssigen) Erklärung dem Erklärungsempfänger gegenüber ein Verhalten gesetzt, das primär zwar einen anderen Zweck verfolgt, dem aber dennoch ein Erklärungswert zukommt, der aus dem Verhalten und den Begleitumständen geschlossen wird. Wenn also eine Zahlungsfrist schriftlich vereinbart wird – sei es auch in AGB –, ist sie nach dem österreichischen Begriffsverständnis ausdrücklich vereinbart.
Bisher musste man daher primär darauf achten und prüfen, ob die Zahlungsfrist an einer Stelle vermerkt war, die Eingang in den Vertrag gefunden hat. Stand die Zahlungsfrist am Angebot, das angenommen wurde, wurde sie zumindest der Form nach richtig vereinbart. Stand die Zahlungsfrist in AGB, auf die das Angebot verwiesen hat und diesem beilagen, so wurde sie zumindest der Form nach richtig vereinbart.
Dass einzelne Klauseln von AGB nicht gültig sind, kannte man bisher zwar auch schon, doch traf dies bisher keine üblichen Klauseln über Zahlungsfristen im B2B-Bereich. Zielte man auf die Unwirksamkeit der Bestimmung ab, so ging es bisher immer um deren Inhalt (dazu gleich unten), nicht aber um die Form der Vereinbarung.
Nach der jüngsten Entscheidung des EuGH ist dies nun anders, weil der EuGH offenbar dem Begriff „ausdrücklich vereinbart“ eine andere Bedeutung beimisst. Es ist demnach zwar möglich, dass eine Klausel über eine Zahlungsfrist in vorformulierten Vertragsbestimmungen (AGB, Ausschreibungsbedingungen) enthalten ist, aber die bloße ausdrückliche Erwähnung darin reicht nicht aus. Nach dem EuGH muss die betreffende Klausel in den Vertragsunterlagen hervorgehoben sein, um sie klar von den anderen Klauseln des Vertrags zu unterscheiden und damit ihren Ausnahmecharakter zum Ausdruck zu bringen und um es der anderen Partei somit zu ermöglichen, ihr in voller Kenntnis der Sachlage zuzustimmen.
Auch die österreichische Regelung ist so anzuwenden, dass sie dem EU-Recht nicht widerspricht. Eine Vereinbarung über eine Zahlungsfrist ist daher nunmehr im Licht dieser EuGH-Entscheidung immer mehren Prüfschritten zu unterziehen:
Wurde die Klausel individuell ausgehandelt? Wenn ja, gilt es, die Klausel inhaltlich zu prüfen. Wenn nein, weil die Klausel in einem vorformulierten Standardvertrag, z.B. AGB, Ausschreibungsbedingungen enthalten ist, gilt es zunächst zu prüfen, ob die betreffende Klausel in den Vertragsunterlagen hervorgehoben wurde, um sie klar von den anderen Klauseln des Vertrages zu unterscheiden, um damit den Ausnahmecharakter zum Ausdruck zu bringen. Wenn ja, findet doch noch eine inhaltliche Prüfung statt; wenn nein, gilt die Klausel als nicht rechtswirksam vereinbart.
Wenn eine längere Zahlungsfrist formal wirksam vereinbart ist, muss noch geprüft werden, ob sie auch vereinbart werden durfte, sprich ob sie auch nicht grob nachteilig für den Gläubiger ist. Ob etwas grob nachteilig ist, bestimmt sich an der Abweichung von der Übung des redlichen Verkehrs, ob es einen sachlichen Grund für diese Abweichung gibt und um welche Vertragsleistung es sich handelt. Es kommt somit stark auf die Umstände des Einzelfalls an.