Nach Mega-Insolvenz 2013 : Alpine-Gläubiger erhalten weitere 40 Millionen
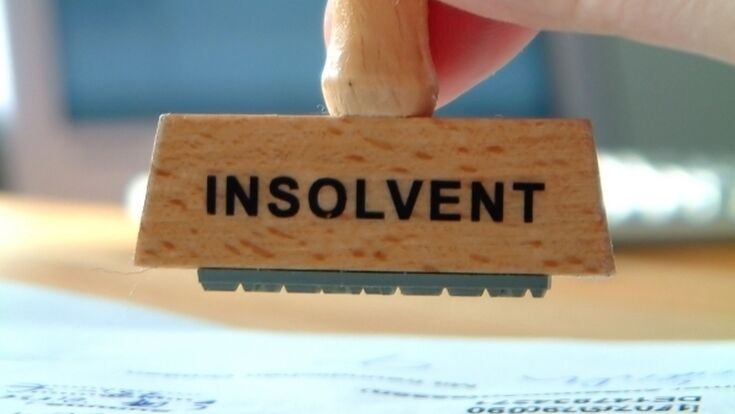
Im Juni 2013 meldete die Alpine Bau GmbH Insolvenz an. Es war die bis dahin größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte und erschütterte nicht nur die heimische Baubranche, sondern auch Banken, Lieferanten, Subunternehmen und tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwölf Jahre später erhalten die Gläubiger erneut einen Teil ihrer Forderungen zurück: Laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform ist eine vierte Zwischenverteilung in Vorbereitung. Rund 40 Millionen Euro sollen noch im Juni dieses Jahres ausgeschüttet werden.
>> Nie mehr eine wichtige Neuigkeit aus der Baubranche verpassen? Abonnieren Sie unseren viel gelesenen Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung!
Rückblick auf einen beispiellosen Konkurs
Die Insolvenz der Alpine war ein Erdbeben für die Bauwirtschaft. Der damals hinter der Strabag zweitgrößte Baukonzern Österreichs beschäftigte zur Zeit der Pleite rund 6.500 Mitarbeiter im Inland und war in zahlreichen Bauprojekten im Hoch- und Tiefbau, im Verkehrswegebau sowie im internationalen Geschäft engagiert. Die Passiva beliefen sich auf rund 2,5 Milliarden Euro – eine Dimension, die bis dahin unerreicht war und erst zehn Jahre später durch den Kollaps der Signa-Gruppe übertroffen werden sollte.
>> Lesen Sie hier alle Artikel zur Alpine-Pleite auf solidbau.at!
Auslöser für die Insolvenz waren massive wirtschaftliche Schwierigkeiten, die unter anderem auf unprofitable Auslandsprojekte, hohe Vorfinanzierungskosten und eine gescheiterte Restrukturierung zurückzuführen waren. Die spanische Muttergesellschaft FCC, die damals rund 93 Prozent der Alpine-Anteile hielt, verweigerte im Juni 2013 die notwendige Finanzspritze. In der Folge blieb dem Unternehmen nur der Gang zum Konkursgericht.
Die ursprüngliche Quotenaussicht lag im einstelligen Prozentbereich und wird mit einer Quote von derzeit 16,5 Prozent weit übertroffen.Stephan Mazal, Creditreform-Insolvenzexperte
Verfahren mit vielen Unwägbarkeiten
Die Abwicklung der Insolvenz gestaltete sich von Beginn an als äußerst komplex. Neben dem Verkauf von Unternehmensbereichen und Immobilien mussten Forderungen geprüft, Vermögenswerte verwertet und zahlreiche Rechtsstreitigkeiten geführt werden. Trotz anfänglich pessimistischer Prognosen konnten die Insolvenzverwalter im Laufe der Jahre beträchtliche Mittel für die Gläubiger sichern.
Bereits 2016, drei Jahre nach Insolvenzeröffnung, erfolgte eine erste Zwischenverteilung in Höhe von 100 Millionen Euro. 2018 folgte eine zweite Auszahlung über 70 Millionen Euro, 2021 eine dritte Tranche von 80 Millionen Euro. Mit der nun angekündigten vierten Zahlung steigt die Gesamtsumme der an die Gläubiger ausgeschütteten Beträge auf 290 Millionen Euro.
„Die ursprüngliche Quotenaussicht lag im einstelligen Prozentbereich und wird mit einer Quote von derzeit 16,5 Prozent weit übertroffen“, erklärte Creditreform-Insolvenzexperte Stephan Mazal. Angesichts der Höhe der Verbindlichkeiten bleibt der wirtschaftliche Schaden dennoch enorm: Gläubiger mussten Forderungsausfälle in Milliardenhöhe hinnehmen.
Finale Quote weiter offen
Mit der bevorstehenden Auszahlung ist die Masseverwertung laut Creditreform im Wesentlichen abgeschlossen. Dennoch bleibt das Insolvenzverfahren weiterhin offen – vor allem aufgrund anhängiger Verfahren gegen ehemalige Gesellschafter und Geschäftsführer der Alpine-Gruppe. Ob es am Ende zu einer weiteren, möglicherweise nennenswerten Schlussquote kommt, hängt maßgeblich von den Ergebnissen dieser juristischen Auseinandersetzungen ab.
„Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis das Verfahren endgültig abgeschlossen werden kann“, so Creditreform. Bis dahin bleibt für viele Betroffene ungewiss, ob sie weitere Gelder erwarten dürfen.
Lehren aus der Pleite
Die Insolvenz der Alpine hat nicht nur die Baubranche aufgerüttelt, sondern auch Fragen nach den Ursachen und strukturellen Schwächen der Branche aufgeworfen. Kritiker bemängelten nach dem Zusammenbruch insbesondere die aggressive Preispolitik in der Bauwirtschaft, die Übernahme internationaler Großprojekte mit unkalkulierbaren Risiken sowie die hohe Abhängigkeit von Vorfinanzierungen.
Auch das Verhältnis zwischen Generalunternehmern und Subunternehmen geriet nach der Alpine-Pleite verstärkt in den Fokus. Zahlreiche Subfirmen blieben damals auf offenen Rechnungen sitzen, mit teils existenzbedrohenden Folgen.
Nachwirkungen für die Branche
Die Alpine-Insolvenz führte in den Jahren danach zu einer verstärkten Sensibilisierung im Umgang mit Großinsolvenzen in der Baubranche. Auftraggeber achten seither verstärkt auf die Bonität ihrer Vertragspartner, auch Sicherungsinstrumente wie Haftungsübernahmen, Treuhandmodelle oder Zahlungsgarantien haben an Bedeutung gewonnen.
Trotzdem zeigte zuletzt die Insolvenz der Signa-Gruppe, dass die Risiken in der Bau- und Immobilienwirtschaft auch zwölf Jahre nach der Alpine-Pleite keineswegs gebannt sind. Hohe Fremdfinanzierungen, steigende Baukosten und volatile Märkte stellen Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen.


