Zulieferer : Strom aus Holz - im heimischen Keller
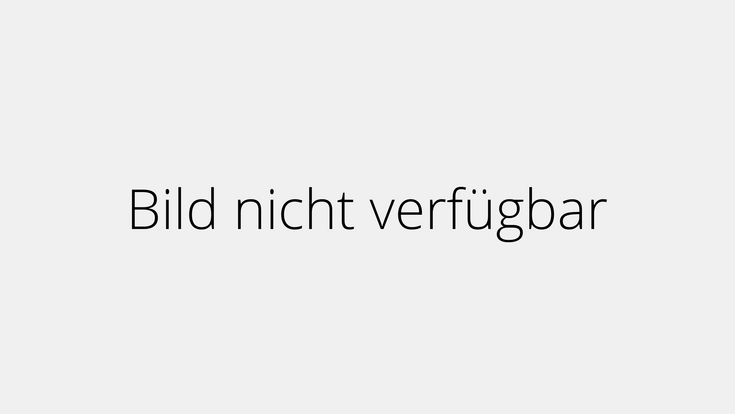
Neubauten in der EU dürfen ab 2020 kaum noch Energie verbrauchen. Darauf haben sich kürzlich EU-Kommission und -Parlament geeinigt. Ein wichtiger Teil dabei wird wohl auch modernen Heizsystemen zukommen. Schließlich bedeute Energieautarkie bei Gebäuden auch, dass Energie erzeugt werden muss, hieß es am 24. November bei einer Veranstaltung zum Thema "Autarkie - Vision oder Wirklichkeit?".Österreich hat massive "Kyoto-Defizite" zu schultern. Immerhin stammen rund 16 Prozent der heimischen Treibhausgas-Emissionen aus dem Sektor Raumwärme. Neben der thermischen Sanierung können auch moderne Heizanlagen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen beitragen. Österreichs Kessellieferanten machen sich daher für Mini-Blockheizkraftwerke stark und rufen nach einer Investitionsförderung.Schon jetzt sind Heizanlagen am Markt, die Strom herstellen können. Die Heizung soll nicht nur Warmwasser bereitstellen, sondern gleichzeitig auch Strom produzieren, forderten Teilnehmer der Veranstaltung: Sprecher der Österreichischen Energieagentur AEA und der Vereinigung Österreichischer Kessellieferanten VÖK. Fernseher, Computer und Kühlschrank mit der eigenen Heizung betreiben zu können, erhöhe die Energieunabhängigkeit und -effizienz.Das Kleinkraftwerk im KellerEine Mikro-Kraftwärmekopplungs-Anlage könnte etwa im Keller eines Einfamilienhauses stehen und soll nicht nur Wärme und Warmwasser bereitstellen, sondern gleichzeitig auch Strom produzieren. Während bei der getrennten Strom- und Wärmeerzeugung nur 63 Prozent der eingesetzten Primärenergie umgewandelt würden, seien es bei den Mikro-KWK-Anlagen bis zu 90 Prozent, sagte AEA-Chef Fritz Unterpertinger. Die Anlagen können beispielsweise mit Öl, Biogas oder Pellets befeuert werden und kosten derzeit noch um die 25.000 Euro, erklärte Markus Telian, Entwicklungs- und Marketingleiter des Liechtensteinischen Heizungstechnikunternehmens Hoval.Auch diese Branche wünscht sich eine "Prämie" Die Branche wünscht sich eine "Markteinführungsprämie" in der Größenordnung von 1.000 bis 3.000 Euro. Obwohl die Technik marktreif sei, führten die Mini-KWK-Anlagen in Österreich "nicht einmal ein Mauerblümchendasein", so Elisabeth Berger von der VÖK. Hierzulande werde primär über thermische Sanierung diskutiert, gleichzeitig forciere man den Fernwärmeausbau. "Da fließt viel Steuergeld in Form von Förderungen." Aus der Sicht Bergers "konterkariert sich das ein bisschen". Wenn die Häuser immer weniger Energie brauchen, müsste Fernwärme viel weiter transportiert werden. Speziell in weniger dicht besiedelten Gebieten kämen die hohen Kosten für die Fernwärmeleitungen hinzu.Industrielösungen marktreifAngesichts dessen müsste der Fokus stärker auf Heizsystemen liegen, die gleichzeitig Strom und Wärme mit geringen Verteilverlusten produzieren. Berger wünscht sich, dass die Förderung der "Mini-Kraftwerke" im Rahmen des zweiten Konjunkturpakets diskutiert wird. Sie sprach sich außerdem für eine "faire" Abgeltung des eingespeisten Stroms aus.Für die Industrie wurden laut den Experten bereits alltagstaugliche Lösungen entwickelt. Seit 2003 gebe es serienreife erd- und flüssiggasbetriebene Mini-BHKWs auf Basis von Ottomotoren mit einer Leistung ab 1,3 kW elektrisch. Seit 2008 sind laut dem VÖK holz- und pelletsbefeuerte Mikro-KWKs (ab 1 kW elektrisch) auf Basis von Stirlingmotoren auf dem Markt.Keine Angaben zur Anzahl Wieviele KWK-Anlagen in Österreich sinnvollerweise errichtet werden könnten und welcher Energieträger am besten geeignet ist, konkretisierten die Experten allerdings nicht. (APA/pm)
